„The notion of ‚really useful knowledge‘ emerged at the beginning of the 19th century alongside the workers’ awareness of the need for self-education. In the 1820s and 1830s, working class organisations in the UK introduced this phrase to describe a body of knowledge that encompassed various ‚unpractical‘ disciplines such as politics, economy and philosophy, as opposed to the ‚useful knowledge‘ proclaimed by business owners who had previously begun to invest more heavily in their companies’ progress through financing workers’ education in ‚applicable‘ disciplines like engineering, physics, chemistry and mathematics.” Ankündigung der Ausstellung „Really Useful Knowledge“ im Madrider Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, kuratiert vom Kuratorinnenkollektiv WHW, 2014/15, die Teil des grösseren langjährigen Projekts „The Uses of Art” war, das a europäischen Museumsnetzwerk L’Internationale seit 2013 organisiert wird.
Kurz nach Beginn der COVID19-Pandemie begann noch vor den ganzen Bars-zu-Testzentren-Transformationen die kritische (meint vermutlich auch: immer und allseits tätige) Kunstmaschine eine neue Produktionsschiene zu bearbeiten: die Reflektion des pandemischen Zustands im betrieblichen Stillstand. Klingt abwertend, war manchmal auch nervtötend, aber häufig genug unterhaltend oder anregend. Ein Highlight in der Zeit war ein kleiner Text von Tom Holert für die zeitweise wöchentliche Online-Kolumne „Notes from Quarantine“ der Zeitschrift Texte zur Kunst, der mich auf meinem eigenen, immer wieder stockenden Gedankenpfad zur Nützlichkeit künstlerischer Produktion vor Ort zumindest vorübergehend ein wenig voranbrachte. Wobei der Begriff der Nützlichkeit gerade in der – sicher nicht nur von mir mitgedachten – Nähe zur Verwertbarkeit für mich weiterhin schwierig zu bearbeiten war. Trotz einiger wertvoller Beiträge dazu in den vergangenen Jahren – wie das im Eingangszitat verlinkte Projekt oder aber die wunderbare von Naomi Hennig und Ulrike Jordan kuratierte Ausstellung „Context is Half the Work. A Partial History of the Artist Placement Group“ 2015 im Kunstraum Kreuzberg.
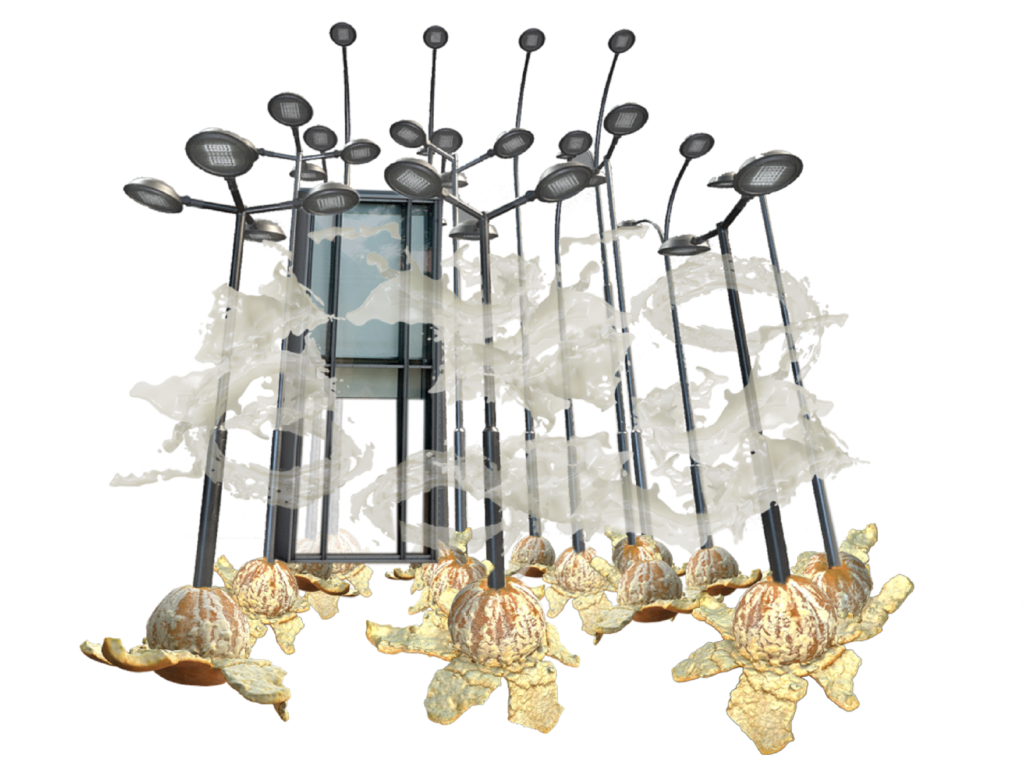
Gleich am Anfang meiner Recherche zu AiR stand die Frage nach dem Verhältnis von Künstler:innen und Lokalität. Die Lokalität ist bei einer AiR in unterschiedlichen Intensitäten durchgehend präsent, wenn Künstler:innen and alike an einem für sie anderen Ort auf bestimmte Zeit recherchieren und produzieren. Der Artist in Residence ist auf soziale, versorgende, informelle, institutionelle oder nahezu geisterhafte Infrastrukturen angewiesen, die das Leben und Arbeiten mit ermöglichen. In ihrer Nutzung werden diese Infra-Strukturen erhalten und mit dem eigenen Beitragen reproduziert – in einer derartigen Alltäglichkeit und einem solchen Nutzen der Lokalität unterscheidet sich das Agieren des Artists in Residence von Besucher:innen oder Touristen, denen Infrastrukturen mehr oder weniger nur versorgend dienen. Das allein ist ein Beitrag zur Lokalität, der nicht zu unterschätzen ist. Tom Holert bringt in seinem erwähnten Kolumnentext aber einen grundlegenden Aspekt ins Spiel: „dass Kunst ja auch ganz voraussetzungslos, immateriell, Ressourcen schonend, also eine Art Grundversorgung sein könnte, das heißt: unabhängig von den Apparaten und Systemen (und den mit diesen verbundenen ideologisch-sozialdynamischen Zwängen), denen sie (und die in diesen arbeitenden Individuen und Kollektive) ihre Verwundbarkeit verdankt.“ Um daraus dann an die Nützlichkeit von Kunst zu erinnern: „Um die Robustheit [noch so eine interessante Vokabel in diesem Zusammenhang] der Kunst zu stärken, wird schon seit Längerem die Tradition einer „nützlichen Kunst“ wiederbelebt.“ Und eben auch auf Projekte, wie das mit dem Eingangszitate erwähnte, verwiesen.
Es scheint mir für eine weitere Praxis einer auch lokal nützlichen Kunst im Rahmen von AiR und Künstlerhäuser notwendig, die historischen wie zeitgenössischeren Projekte näher in Betracht zu ziehen (etwas, das in diesem Beitrag ausbleiben muss). Denn eine Nützlichkeit unterscheidet sich im Sinne der von Tom Holert erwähnten Grundversorgung von einem in-den-Dienst-stellen oder einer Funktionalität und kann auch keine künstlerischen Aneignung von Nachbarschaft unter dem Deckmantel der Partizipation meinen. Es wäre vielmehr angebracht, ein gemeinschaftlich herzustellendes und teilbares Wissen anzustreben, das spezifisch sein darf oder vielleicht auch nur spezifisch sein kann. Dies würde zum einen nicht nur von der einen häufig auch verklärten Nachbarschaft ausgehen, sondern diese oder Teile von ihr in ihren Kapazitäten, Ressourcen, Interessen, Wünschen und Dringlichkeiten adressieren (und andere Teile von ihr eben nicht) und könnte mit dieser und für diese vor Ort wirksam werden. Es würde andererseits ein Erfassen und möglicherweise auch bleibendes Aufzeichnen der Lokalität in der beteiligten künstlerischen Praxis gewähren und mit dieser über den Ort hinausgehen.
Auf eine andere Formen des Wirkens vor Ort machte mich die Kulturwissenschaflerin Stephanie Koch aufmerksam, die ich bei einem Recherchebesuch im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop zufällig (so zufällig, wie das bei einem Immerneuzusammenkommen von Resident:innen und Besucher:innen in Künstlerhäusern der Fall ist) kennenlernte. In ihrer Masterarbeit beschreibt sie Bangalore Residency, ein Programm, in dem gemeinsame oder geteilte Gastgeberschaften praktiziert werden, also eine Zusammenarbeit mehrerer Räume, Institutionen, Akteur:innen, die ein Vermögen, eine Praxis, eine Geschichte, eine Fragestellung, ein Wissen anbieten, das als Möglichkeit Teil einer künstlerischen Forschung einer Gastkünstler*in sein kann. Dazu wird es noch einen gesonderten Beitrag geben.
